Das gesellschaftliche Klima war sehr anders zu dieser Zeit. Springers "Welt" kanzelte rechte Abschottungsideen à la Friedrich und Köppel als "vollkommen absurd" ab. "Was bedeuten diese Toten? Was verlangen diese Toten?", fragte der "Spiegel" und beantwortete es mit der Überschrift: "Knackt die Festung Europa!" Sahra Wagenknecht, damals noch Chefin der Linken, stieg vor dem Bundestag in orangener Warnweste in ein Gummiboot, um auf engstem Raum mit 120 anderen nachzufühlen, wie sich wohl ein Mensch auf der Flucht fühlen muss.
Inzwischen erscheinen im "Spiegel" auch Beiträge, in denen etwa der Futurist Alex Steffen mit Blick auf hitzebedingt unbewohnbar werdende Erdregionen ausbreitet, dass die "halbwegs klimarobusten" Flecken zum "Flaschenhals" würden. Ohne Triage werde es nicht gehen. Dann gebe es Orte wie Manhattan, "in denen sich Geld, Macht und Kultur konzentrieren, die werden um fast jeden Preis verteidigt." Die "Welt" lässt indessen den reichsten Faschisten der Welt Wahlwerbung für eine rechtsextreme Partei machen. Und im Programm zur Bundestagswahl verwies das Bündnis Sahra Wagenknecht unter dem Zwischentitel "Sichere Grenzen, sichere Straßen" auf die Anzahl der von Asylbewerbern verübten Sexualdelikte.
Für Grodotzki ist die Entwicklung ein Grund zu reflektieren, berichtet der 36-Jährige im Gespräch mit Kontext. Die Verwirklichung politischer Ansprüche, etwa die Forderung nach sichereren Fluchtrouten, würde zuletzt in immer weitere Ferne rücken, da müsse sich die Bewegung schon fragen: "Sind wir in eine Sackgasse gelaufen?" Am Sinn und Zweck, Menschenleben zu retten, zweifelt er nicht. Aber es gehe ihm auch darum, "die Strategien und Taktiken, die wir angewendet haben, die Organisationsformen, zu überprüfen: Haben wir da Erfolge gezeigt? Aus welchen Fehlern können andere Bewegungen lernen?" Daneben sei eine weitere Motivation, endlich "die ganzen verrückten Geschichten aus den ersten Jahren aufzuschreiben, die man damals niemandem so richtig erzählen konnte" – sonst hätte wohl die Reputation "unseres ohnehin nicht unumstrittenen Projekts" zu stark gelitten.
Sektengründer ohne Sprachkenntnisse
Denn tatsächlich handelte es sich beim ersten Sea-Watch-Schiff um einen knapp 100 Jahre alten Fischkutter aus Amsterdam, der restauriert und umgebaut werden musste. Das nötige Kleingeld dafür stammte zunächst, wie Grodotzki es formuliert, aus dem Firmenvermögen eines "Klimbim-und-Klamotten-Handels", weil Harald Höppner vor dem Kapitel Seenotrettung als "Hippieausstatter" sein Geld verdiente. Viel lief in der Anfangszeit nach dem Motto: Machen statt quatschen.
Daher war das Personaltableau der ersten Missionen mitunter etwas merkwürdig. Gehen musste etwa der Übersetzer Idji, der "aufgrund seines beeindruckenden Kompetenzprofils engagiert worden war", schildert Grodotzki: "Neben seinen vielseitigen Sprachkenntnissen produziere der blinde Aktivist auch sehenswerte Youtube-Videos und sei psychologisch ausgebildet. Damit könne er auch gleich die Betreuung der Crew vor und nach dem ersten Einsatz übernehmen." So jedenfalls die Erwartung. Leider konnte Idji dann gar kein Italienisch. "Sein psychologisches Know-How bestand in dem durchaus beeindruckenden Kunststück, einigen Hippies weiszumachen, er sei ein blinder Shaolin-Mönch, der mittels Echolot seine Umgebung wahrnähme und so, unter anderem, Basketbälle einkorben könne. Idjis aktivistische Erfahrung wiederum – oder das, was dem am nächsten kam – war die Gründung einer Sekte in Frankreich sowie seine darauffolgende Flucht vor den Behörden nach Malta."
Solche Szenen beschreibt Grodotzki nicht mit klassisch-journalistischer Distanz: "Ich war ja mittendrin, habe das Medienteam der Sea Watch mit aufgebaut und da ein paar Jahre Vollzeit gearbeitet – wenn auch meist unbezahlt." Entsprechend ordnet er sich eindeutig als Aktivisten ein. Auch als Fotograf verstehe er sich nicht als neutraler Beobachter, der wie ein Geist durch die Szenerie schwebt. Er unterhalte sich gerne mit den Leuten vor der Linse. Und er scheut sich nicht, Partei zu ergreifen, wo Menschenrechte nicht für alle gelten.
Angefangen hat Grodotzki seine aktivistische Laufbahn in früher Jugend, aufgewachsen in der schwäbischen 8.000-Seelen-Gemeinde Hemmingen, wo er mit seiner punkigen Erscheinung mit der lokalen Nazi-Szene aneinandergeriet. Später erfolgte das Engagement bei einer Ludwigsburger Antifa-Gruppe, über die sich immer mehr politische Kontakte ergaben, bis Grodotzki auch beim Thema Umweltschutz landete. 2007 beteiligte er sich an Besetzungen von Feldern, auf denen gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut werden sollten, ein Jahr später lebte er in Baumhäusern im Kelsterbacher Wald bei Frankfurt. Dort sollten 100.000 Bäume für eine Expansion des Flughafens weichen. Das rief die erste Waldbesetzung der deutschen Klimabewegung auf den Plan, sie blockierte neun Monate lang die Fällarbeiten. Am Ende wurde gerodet.
Symbiotische Zusammenarbeit
Bei seiner Zeit unter Baumwipfeln lernte Grodotzki den späteren Sea-Watch-Co-Gründer Ruben Neugebauer aus Reutlingen kennen, über den er schreibt: "Ruben und ich waren mehr als Kollegen. Wir waren Genossen; Komplizen im täglichen Aufstand gegen die herrschenden Verhältnisse. Staat und Kapital hatten wir seit frühester Jugend, aus unterschiedlichen Ausgangspositionen und Gründen, persönlich den Krieg erklärt." Zusammen arbeiteten sie in einem Kollektiv, das sozialistisch experimentierte: zum Beispiel mit einem geteilten Konto. "Dabei bildeten wir eine Art Symbiose: Ich war eher strukturiert, brachte mit Fotoaufträgen aus der NGO-Welt die Brotjobs nach Hause und fokussierte mich ansonsten auf die Fotodokumentation autonomer Umweltaktionen. Ruben war ein Chaot im besten Sinne und schien eigentlich nie zu schlafen. Er streckte seine Fühler in alle möglichen Richtungen aus, und sobald ein Politprojekt auch nur annähernd vielversprechend klang, konnte man sicher sein, dass er seine Finger im Spiel hatte." So auch bei der Sea-Watch-Gründung.
Dabei waren die ersten Tage auf Rettungsmission ein wüster Realitätscheck für die Crew. "Etwa in der Mitte ihres Patrouillengebietes liegt die libysche Hauptstadt Tripolis", schreibt Grodotzki. "Auf dieser Höhe dümpelt die Sea-Watch auf ihrer ersten Mission, als Aktivist:innen des 'Watch the Med Alarm Phone' sie über einen Notruf nördlich von Zuwara informieren, 50 Seemeilen westlich des kleinen blauen Hilfskutters. Ein Schlauchboot mit 150 Menschen habe Leck geschlagen und sei am Sinken. Als die Besatzung Kurs auf das weit entfernte Ziel nimmt, ist bereits klar, dass ihre Chancen, rechtzeitig einzutreffen, verschwindend gering sind. (…) Die voraussichtliche Zeit bis zum Ziel: 6 Stunden und 15 Minuten. (…) Dann der nächste Notruf vom 'Alarm Phone': 200 Menschen in einem Boot, das von Misrata abgelegt hatte – ganz am anderen Ende des Patrouillengebietes. Die Sea-Watch würde zehn Stunden brauchen, um dort einzutreffen. Manche der Passagiere seien bewusstlos, eventuell sogar schon tot. ‚Es war unmöglich, mit Vollgas die libysche Küste entlang zu fahren, zu Booten in Seenot, die wir niemals rechtzeitig erreichen konnten‘, grübelt Harald. 'Wir konnten nicht Kurs auf alle Seenotfälle nehmen, die bei uns eingingen. Das Gebiet war zu groß, die Sea-Watch zu langsam, die Zahl der Notfälle zu hoch.' Eine bittere Erkenntnis, die sich in den kommenden zehn Jahren zahllose Male wiederholen würde."













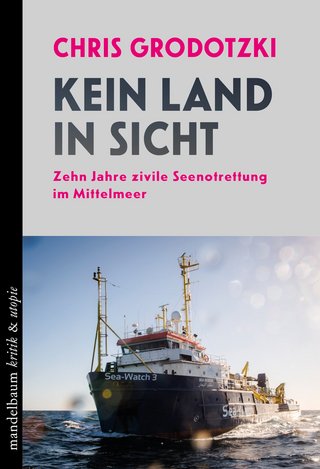









0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!