Ohnehin lohnt der Blick zurück. Wäre es nach den Plänen von vor zwei Jahrzehnten gegangen, damals vehement vertreten durch einen gewissen Winfried Kretschmann, hätten schon 2006 geborene Kinder von der neuen neunjährigen Basisschule im ganzen Land profitieren können, also von der Überwindung des selektiven Schulsystems. "Integrativen Schulsystemen gelingt es besser, den Erwerb der Grundkompetenzen zu sichern und gleichzeitig Spitzenleistungen zu erzielen", hieß es in einschlägigen Beschlüssen, etwa beim Landesparteitag 2005 in Bad Saulgau. Nicht nur die Sekundarstufe I sollte verändert werden, sondern alle Kinder von der ersten bis zur neunten Klasse sollten vom gemeinsamen Lernen und Lehren verbunden mit individueller Förderung profitieren. "Wir haben Ideale und Visionen", strotzte sogar Ex-Pädagoge Kretschmann geradezu vor Reformeifer. Gute Schulen, deren Angebote für alle Schichten gleichermaßen zugänglich seien, beschrieb er als "Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit".
Diese Positionierung blieb keine Eintagsfliege. Im Gegenteil. Das vier Jahre später in Bruchsal beschlossene Wahlprogramm liest sich ebenso glasklar: Die CDU/FDP-Landesregierung habe das Schulsterben im ländlichen Raum massiv beschleunigt. Aktiv unterstützen wollten die Grünen deshalb das Anliegen vieler Kommunen, ein größtmögliches Angebot durch weiterführende Bildungswege innerhalb einer Schule auszugestalten. Geplant war die Einführung von zwei- oder dreizügigen Basisschulen als Gemeinschaftsschulen, denn bei gezielter regionaler Planung könne in zwei von drei Gemeinden eine Sekundarschule entstehen. Im Koalitionsvertrag 2011 mit der SPD ist zwar das Wort "Basisschule" verschwunden, nicht aber die auf vielen internationalen Studien basierende Erkenntnis, dass sich "unsere bildungspolitischen Ziele in der Gemeinschaftsschule für alle Kinder bis Klasse 10 am besten erreichen lassen".
Delegierte sollten alte Beschlüsse vortragen
Die damaligen Versprechungen der Befürworter:innen sind aktueller denn je: mehr Chancengleichheit, gute Ressourcenausstattung, bestmögliche individuelle Förderung, Sicherung wohnortnaher Schulstandorte mit breitem Angebot an Schulabschlüssen – insbesondere in den ländlichen Räumen –, effiziente Nutzung finanzieller Spielräume. Sie umzusetzen ist aber mit den jetzt vorliegenden Plänen der Südwest-Grünen unmöglich. Und Artikel 11 der Landesverfassung steht weiterhin nur auf dem Papier: "Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung."
Am besten wäre es, wenn beim Landesparteitag Mitte Dezember in Ludwigsburg, der das Wahlprogramm 2026 endgültig verabschieden soll, Delegierte einfach die Beschlusslage früherer Jahre vortragen – damit sich die Verfasser:innen des Programmentwurfs erinnern und rückbesinnen. Selbst der Ministerpräsident könnte sich einreihen, hat er doch noch in seiner Regierungserklärung im Mai 2024 mehr Übersichtlichkeit in der Schullandschaft versprochen, weil Baden-Württemberg eines der komplexesten Schulsysteme der Republik habe. Das überfordere nicht nur viele Eltern, sondern binde auch zu viele Ressourcen. Und die KI, gefüttert mit eben jenen Erkenntnissen, sagt auf eine Frage dazu: "Ja, es gibt die politische und öffentliche Wahrnehmung und Kritik, dass das Schulsystem Baden-Württembergs eines der komplexesten in Deutschland sei."
Sein Versprechen von "mehr Klarheit in der Struktur" hat der Ministerpräsident ebenso gebrochen. Denn tatsächlich wurde das Angebot ausgeweitet. Bisher gab es das neunjährige Gymnasium (G9) nur auf dem Beruflichen Gymnasium, seit Schulbeginn ist es aufs allgemeinbildende Gymnasium mit Klassen fünf und sechs ausgeweitet. Wie viele alte G8-Standorte ab der Fünften landesweit noch im Angebot sind – in Stuttgart ist es das Karls-Gymnasium –, weiß das Kultusministerium im stetigen Bemühen um Klarheit nicht. Und die KI erst recht nicht. Fragt man sie, sind Wohlfühlorte "ein innerer, mental vorgestellter Ort (...), der durch Imagination erschaffen wird". Das wird Kindern und Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften im Land schwerlich reichen. Um nicht neue Zauberworte, sondern das gute alte Schulvokabular zu nutzen: Es wird den Grünen wenig anderes übrig bleiben als nachzusitzen – ausreichend gute Noten könnten sonst im nächsten März ziemlich gefährdet sein.







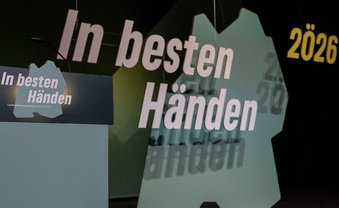







0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!