Viel steht auf dem Spiel, da sind alle seriösen Fachleute einig: der Durch- und Einblick in Verwaltungshandeln, in umstrittene Entscheidungen vor Ort in Kommunen, in Landesregierungen oder im Bund. Es geht um das gegenseitige Verstehen, die offensive Information der Bürger ebenso wie um Auskünfte zu Umwelt- und Verbraucherfragen oder Auskünfte ganz grundsätzlich an Journalist:innen. Es geht, kurz, um Transparenz und damit letztlich auch um Vertrauen. Seit Jahren kämpfen Organisationen wie die Open Knowledge Foundation Deutschland e. V. (OKFDE) in Berlin dafür, dass all jene, die privat oder beruflich an Vorgängen interessiert sind, einen direkten Zugang zu behördlichem und zu Regierungshandeln bekommen – und zwar so niederschwellig wie möglich. Die OKFDE unterhält bereits seit 2011 das Internetportal "FragdenStaat.de". Ziel sei, heißt es in einer Selbstdarstellung, "nicht ewig die gleichen Kämpfe auszutragen", sondern Impulse zu geben "für einen langfristigen und nachhaltigen Wandel zu einer transparenten Kultur".
Was den Kulturwandel angeht, hat sich in den letzten Jahren durchaus einiges getan. Organisationen, Bundesministerien oder Länder haben leichtere Zugangsmöglichkeiten zu Informationen geschaffen. Baden-Württemberg wollte vor vier Jahren noch dazugehören. "Wir werden auf Basis der Evaluationsergebnisse das Landesinformationsfreiheitsgesetz zu einem Transparenzgesetz weiterentwickeln, das einen angemessenen Zugang zu Informationen der öffentlichen Verwaltung gewährleistet und eine sachgerechte, proaktive Veröffentlichung von Daten vorsieht", heißt es im Kapitel "Inneres und Verfassung" des im Frühjahr 2021 verabschiedeten Koalitionsvertrags der grün-schwarzen Landesregierung.
Eine Evaluierung liegt vor, doch Strobl will eine neue
Was in Sachen Transparenz möglich und was wünschenswert ist, ist längst bekannt. Erste Evaluierungsergebnisse liegen seit inzwischen vier Jahren vor. Stefan Brink, der damalige Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), warb für die Einsicht in die Tatsache, dass die Latte für Veränderungen in Baden-Württemberg besonders hoch liegt. Weitreichende Verbesserungen wurden vorgeschlagen und zugleich Erläuterungen geliefert, warum die nötig sind. Die Handlungsempfehlungen seien von derart "umfassend und tiefgreifender Art", weil das Land schon 2015 – mit seinem von Grün-Rot verabschiedeten ersten Informationsfreiheitsgesetz überhaupt – hinter den bundesweit erreichten Standards deutlich zurückgeblieben sei. Ein Abstand, der immer größer geworden ist. Denn andere Bundesländer haben ihre Regelungen inzwischen fortentwickelt, anders als Grüne und CDU für den Südwesten.



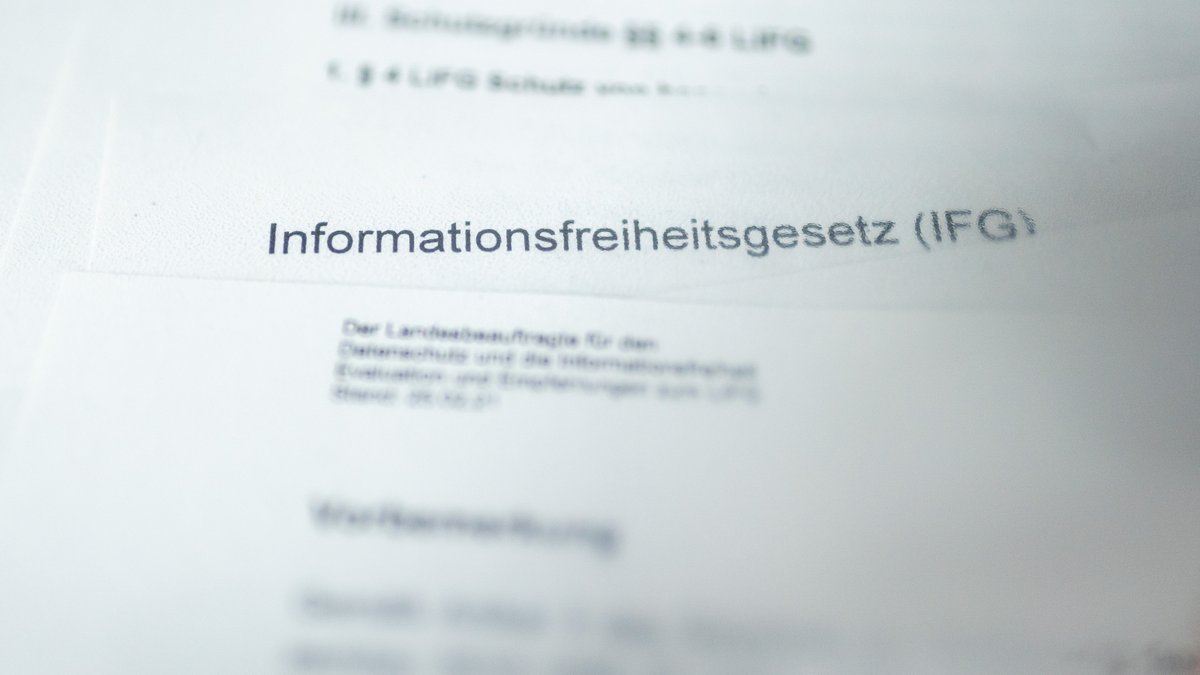








0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!