Noch dringen mahnende Stimmen aus der Tourismus-Branche kaum durch, dass die zwölf Prozentpunkte Steuerentlastung wegen des Kostendruck gar nicht ankommen werden bei den Gästen. Oder dass sie schon im Sommer kommen müsse, um massenhafte Pleiten zu verhindern. Die Vorverlegung ist aber hochgradig unwahrscheinlich und fände ohnehin nur dann statt, wenn auch das kleiner Gedruckte im Koalitionsvertrag Gegenstand jener öffentlichen Diskussionen würde, die bei Großvorhaben derzeit und rund um den SPD-Mitgliederentscheid schon vielstimmig geführt werden.
Stichwort Mindestlohn. Zu den 15 Euro ab dem kommenden Jahr gibt es ganz unterschiedliche Ansichten bei den mutmaßlichen Regierungsparteien Union und SPD, unter Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden sowie eher linken, eher rechten oder liberalen Wirtschaftswissenschaftler:innen. Die zuständige Kommission will noch vor der Sommerpause ihr Beratungsergebnis vorlegen. Allein die Tatsache, dass bisher unberücksichtigt gebliebene EU-Vorgaben eingearbeitet werden müssen, legt eine Entscheidung für das 15-Euro-Niveau oder sehr in der Nähe nahe. Ganz zu schweigen von den positiven Auswirkungen, die diese spürbare Anhebung auf die Binnenkaufkraft haben würde, zumal in der neuen Ära von Zöllen und Exporthemmnissen.
Unternehmer:innen sind sauer
Ganz anders kalkulieren die einflussreichen "Unternehmer Baden-Württemberg" (UBW). "Der Mindestlohn ist seit seiner Einführung mit 8,50 Euro auf heute 12,82 Euro stärker gestiegen als die allgemeinen Löhne und stärker als die Tarifentgelte", heißt es in einem Appell mit dem Titel "Hände weg von der unabhängigen Mindestlohnkommission". Dieses Plus von mehr als 50 Prozent habe "auch den stärkeren Anstieg der Verbraucherpreise in den letzten Jahren mehr als wettgemacht". Also gebe es weder eine Begründung noch eine Notwendigkeit für einen erneuten politischen Eingriff oder politischen Druck. Für ihre ideologische, will sagen: interessengeleitete Argumentation ziehen die UBW einen Vergleich mit der Ausbildungsvergütung heran: Wenn der Mindestlohn zu stark steige, sei es unattraktiv, einen Beruf zu erlernen. Die Idee, Azubis mehr Geld zu zahlen, um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken, hat in diesem Weltbild keinen Platz.
Für die Vielzahl und die Bedeutung im Koalitionsvertrag geradezu angelegter Konflikte steht eine bemerkenswerte Rede von Nicola Leibinger-Kammüller Anfang Februar vor Weltmarktführer:innen in Schwäbisch Hall. Die Trumpf-Chefin, die den Maschinenbauer seit inzwischen mehr als 19 Jahren führt, hält so gar nichts von immer neuen Verteilungsdebatten, von der angeblich überbordenden Regulierungswut der EU, von Förderprogrammen und einem "Subventionswettlauf". Der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg stehe vor der Wahl, weiterzugehen in Richtung Dirigismus und Staatsgläubigkeit oder zu Vertrauen in Markt und Wirtschaft. Als Beispiel dient ihr das "Lieferkettendings", wie sie das Gesetzeswerk zu nennen beliebt, das helfen sollte, im globalen Handel Arbeitnehmer- und Menschenrechte und das Klima besser zu schützen.




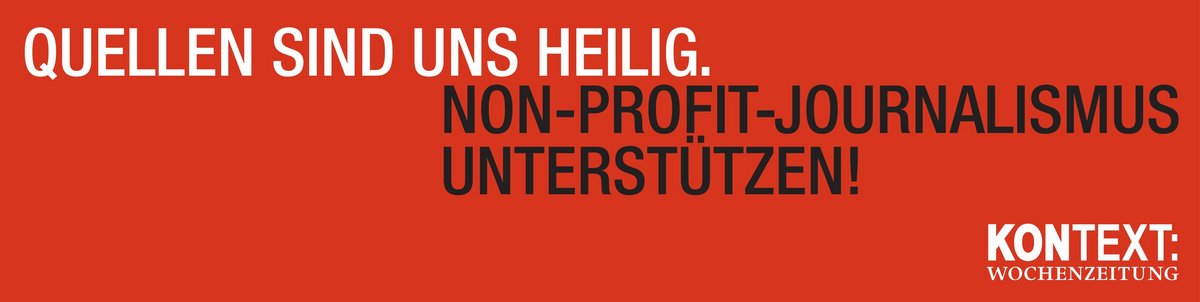







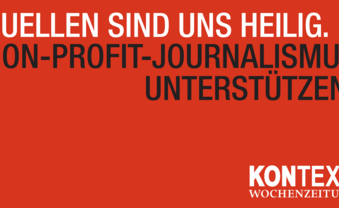


0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!