Doch wie ist nun der Stand auf dem Gelände, wie weit sind die Planungen, ab wann wird gebaut? Kontext hat bei den Makern der "Maker City" nachgefragt, die auf dem Areal entstehen soll: Die Container City, die den Mitgliedern des Kunstvereins während der Sanierung der Wagenhalle als Ausweichquartier für Ateliers, Büros und Proberäume diente, ist seit Ende 2024 weg. Doch der Stadtacker, ein seit 2012 bestehender Gemeinschaftsgarten, der bereits vor vier Jahren verschwinden sollte, ist immer noch da.
Beim Quartier geht noch nicht viel voran
Eigentlich sollte die Entwicklung des Quartiers mit ökologisch-sozialen Wohnformen, Gewerbeflächen und sozialen Einrichtungen zur Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA’27) bereits viel weiter sein. Das verkündet auch noch die IBA-Webseite: "Grundstücksvergabe für die ersten Gebäude: 2025, im Bau: 2027", heißt es dort zum "Quartier C1 Wagenhallen". Das ist nicht mehr aktuell. "Wir kümmern uns jetzt um die Projekte, bei denen es vorwärts geht", erklärt der Pressesprecher Tobias Schiller auf Anfrage. Hier geht noch nicht viel voran. Baubeginn soll, Stand heute, 2028 sein. Das hat seinen Grund: Bevor auf dem ehemaligen Gleisfeld gebaut werden kann, müssen Wasser- und Abwasserleitungen verlegt werden – die gesamte Infrastruktur.
Noch davor müssen die Eidechsen auf dem Gelände weichen. Sträucher und Geröll, wo sich die Tiere verkriechen könnten, wurden entfernt, und auch einige Bäume wurden gefällt, was den Protest des Nabu und des Aktionsbündnisses gegen S 21 nach sich gezogen hatte. Letzteres hatte auch kritisiert, dass die Tiere nicht wie sonst üblich abgesammelt, sondern vergrämt werden sollten. Das scheint aber nicht geplant zu sein. Baubotaniker Schwertfeger erklärt: Sobald eine ebene Fläche hergestellt und mit schwarzen Folien ringsum abgedichtet sei, könne das Absammeln der Eidechsen beginnen. Das passiere zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Derzeit befinden sich die Tiere aber noch im Winterschlaf. Und Ersatzhabitate gibt es bereits, so die Auskunft der Stadt: im Süden und im Osten Stuttgarts.
Nicht alles soll abgeholzt werden
Damit die Künstler:innen und Gärtner:innen weiter werkeln können, wurde das Areal in zwei Abschnitte geteilt: Im ersten Abschnitt, auf dem die Container City war, sollen die Eidechsen in diesem Jahr abgesammelt werden, im zweiten 2026. Dann müssen die Leitungen verlegt werden und für 2028 ist der Baubeginn geplant.
Allerdings soll nicht alles abgeholzt werden. Das Landschaftsarchitekturbüro Greenbox, das mit den Grünplanungen beauftragt ist, zeigt sich aufgeschlossen: Altbäume will es so weit wie möglich erhalten, ebenso die besonderen Orte, die bereits auf dem Areal existieren und auch in Zukunft die Identität des Quartiers prägen sollen.
Dazu gehört das "Theatre of the Long Now" am Ostzipfel des Areals, ein Projekt des Bureau Baubotanik: Baumpflanzung, Biotop, Forschungsstation und ein Theaterstück mit einer Laufzeit von 100 Jahren, das erlaubt, die langfristigen Veränderungen im Blick zu behalten. Zu den Akteuren des "Theaters" gehören Pflanzen, Insekten, Mineralien und eine Schildkröte.
Das Grundprinzip der Baubotanik besteht darin, Bäume so miteinander verwachsen zu lassen, dass anstelle einzelner Stämme ein tragfähiges Gerüst oder Gitter entsteht. Auf diese Weise soll im Lauf der nächsten 100 Jahre vor den Toren der Wagenhalle eine Allee entstehen. Jedes Jahr kommen zwei kreuzweise zusammenwachsende Bäume hinzu. In die Verbindungsstellen der Bäume wird jeweils eine Art Überraschungsei gelegt, das ein kleines Kunstwerk enthält. Worum es sich handelt, werden erst kommende Generationen erfahren, wenn die Bäume so alt sind, dass sie verrotten.
Die Künstler:innen wollen mehr Platz
Vor der Wagenhalle ist ein großer Platz als Quartiersmittelpunkt geplant. Bis es so weit ist, sollen sich die Künstler:innen allerdings mit einem kaum mehr als sechs Meter breiten Streifen zufrieden geben, zu dem eine drei Meter breite Feuerwehrzufahrt gehört, die unbedingt frei bleiben muss. Das wird nicht funktionieren, monierte Robin Bischoff, der Vorsitzende des Kunstvereins: Die Künstler:innen bräuchten mehr Platz vor der Halle. Der Verein hat ausgetestet, wie weit er die Grenze verschieben kann – Künstler:innen handeln lieber, als lange zu reden.












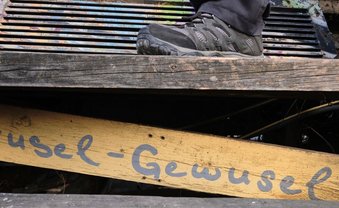

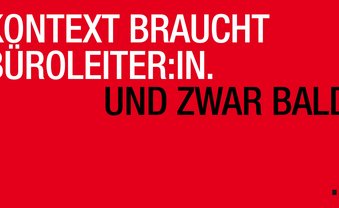



0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!