Am Morgen saß ich noch zusammen mit etwa 200 Kollegen und Kolleginnen in einer großen Sporthalle bei der jährlichen Dienstversammlung. Vorträge, Reden und Statistiken bis zum frühen Nachmittag, danach Personalversammlung. Doch am Vormittag plötzlich die Durchsage: Echtlage. Amoklauf an einer Realschule in Winnenden. Von vielen Toten ist die Rede. Von einem Täter, der zu allem bereit ist. Für ein genaues Briefing fehlt die Zeit. Wir bekommen Fahndungsgebiete zugeteilt. Zusammen mit den beiden Kollegen laufe ich zu dem zivilen Streifenwagen. Bevor ich hinten einsteige, überprüfe ich die Kindersicherung, denn mir ist klar, dass ich sonst in der Falle sitze.
Im Minutentakt kommen neue Schreckensmeldungen über Funk, sofern er nicht völlig zusammengebrochen ist. Im Schritttempo fahren wir durch Kleingartenanlagen mit Streuobstwiesen. Hinter jeder Hecke könnte der Amokläufer lauern und auf uns schießen. Wir suchen nach einem Massenmörder. Wir hoffen, ihn stellen und festnehmen zu können, damit das Töten ein Ende hat. Wie er genau aussieht, wissen wir nicht. Über Funk kommen immer wieder neue Täterbeschreibungen, die Lage ist unübersichtlich. Nach und nach verliere ich das Zeitgefühl. Und je länger sich die Fahndung hinzieht, desto weniger weiß ich, ob ich Jäger bin oder Gejagter.
Über Funk kommt die Meldung, dass der Täter auf der Flucht einen Mann erschossen hat. Jeden Moment rechne ich damit, ihm gegenüberzustehen und damit, dass diese Begegnung nur einer von uns beiden überleben wird. Mir ist klar, dass er in der besseren Ausgangssituation ist, denn er hat den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Jeder, der uns entgegenkommt, könnte der Amokläufer sein. Die Suche nach ihm scheint kein Ende nehmen zu wollen.
Am Vormittag erfahren wir, dass der Täter einen Autofahrer als Geisel genommen hat. Die beiden Kollegen und ich sollen die Fahndung nach ihm abbrechen. Am Sammelort der Polizeikräfte, nahe der Albertville-Realschule, bekomme ich einen neuen Auftrag. Ich soll Schüler befragen, die dem Amokläufer entkommen sind. Sie sind aus der Schule in ein nahgelegenes Schwimmbad gebracht worden. Dort stoße ich auf weinende und panisch schreiende Jugendliche, auf verzweifelte Mütter und Väter, die laut die Namen ihrer Kinder rufen. Auf Lehrer, die umherirren und nach ihren Kollegen suchen. Aufgeregte Stimmen hallen von gefliesten Wänden wider. Stechender Geruch nach Chlor. Diffuses Licht. Szenen, die ich nicht vergessen kann.
Mir fällt eine blasse, zierliche Frau auf, die wie erstarrt inmitten des Chaos steht. Dieses Bild setzt sich in meinem Kopf fest. Später erfahre ich, dass ihre Tochter zu den Opfern gehört. Wir sollen die Schüler, in deren Klassenzimmern der Täter um sich geschossen hat, zum Tathergang befragen. Währenddessen schwimmen einige Badegäste seelenruhig weiter ihre Bahnen und ignorieren alle Bitten des Personals, aus dem Becken herauszukommen. Erst als ich sie über die Lautsprecheranlage der Badeaufsicht dazu auffordere, räumen sie widerwillig den Schwimmbereich.
Ich wende mich einem etwa 14-jährigen Jungen zu, er ist ungefähr so alt wie mein eigener Sohn damals. Ich knie mich neben ihn auf den Boden und versuche, Kontakt zu ihm zu bekommen, einen emotionalen Zugang zu finden. Doch ich kann ihn nicht erreichen. Der Junge wirkt wie gelähmt. Er schaut mit starrem Blick einfach durch mich hindurch. Auf meine Fragen antwortet er abgehackt und monoton wie ein Roboter. Mir wird klar, dass ich von ihm nicht viel über den Täter erfahren kann. Er erzählt mir in Einzelheiten, was er im Klassenzimmer erlebt und gesehen hat. Schüsse, Mitschüler, die zu Boden fielen, ihre starren Augen, das viele Blut, das aus ihren Körpern floss.
Ich beschließe, den traumatisierten Jungen nach Hause zu seinen Eltern zu bringen und stelle fest, dass sich vor der Schule mittlerweile eine Heerschar von Übertragungsfahrzeugen aus der ganzen Welt eingefunden hat. Abgestellt ohne jegliche Rücksicht auf Verkehrsregeln oder private Grundstücke. Ich sehe platt gewalzte Wiesenflächen, abmontierte Zäune, niedergedrückte Verkehrsschilder. Im Zivilfahrzeug fahre ich den Jungen zu seinem nur wenige Kilometer entfernten Wohnort und übergebe ihn seinen völlig aufgelösten Eltern. Dann muss ich weiter.
Nächster Einsatzort: Das Krankenhaus in Backnang. Zusammen mit einem Kollegen soll ich weitere Schüler befragen, die knapp dem Tod entronnen sind. Im Krankenhaus herrscht ein ähnliches Chaos wie im Schwimmbad. Verwirrte Angehörige irren durch die Klinikflure und suchen ihre Kinder. Journalisten der Boulevardpresse sind auch schon da, um den Familien Fotos der Verletzten abzukaufen. Eine Schülerin, die auf der Flucht vor dem Amokläufer von einer Feuerleiter gefallen ist, wird gerade auf eine Operation vorbereitet. Ihre Eltern erzählen uns, dass ihnen ein Reporter einer Boulevardzeitung Geld angeboten hat, um ein Foto ihrer verletzten Tochter machen zu dürfen. Fassungslosigkeit und Wut steigen in mir auf.
Schnell stellen wir fest, dass sinnvolle Befragungen hier nicht möglich sind, zu schwer sind die Verletzungen der Jugendlichen. Wir brechen den Auftrag ab und fahren auf unsere Dienststelle, die Kriminalaußenstelle Backnang. Über Funk habe ich mittlerweile erfahren, dass der 17-jährige Tim K. sich umgebracht hat, nachdem er zwei weitere Menschen in Wendlingen getötet hat. Der Amoklauf ist zu Ende und hat 16 Menschen das Leben gekostet.
In meinem Büro versuche ich gedanklich zu sortieren, was ich bisher an diesem Tag erlebt habe. Immer wieder überwältigen mich dabei Emotionen. Hilflosigkeit, Fassungslosigkeit, mittendrin in so einem Ereignis zu sein. Einem Ereignis, wie ich es als Polizeibeamter noch nie zuvor erlebt habe. Immer noch kann ich nicht begreifen, was bisher geschehen ist. Doch ich habe nicht lange Zeit, nachzudenken. Der Spurensicherung, die bereits vor Ort in der Schule ist, geht das Material aus, es sind einfach zu viele Tote. Ich packe alle Wattestäbchen, Plastikbeutel, Einweghandschuhe und Papiertüten zusammen, die wir auf der Dienststelle vorrätig haben. Dann fahre ich wieder nach Winnenden.
Ein Durchkommen ist kaum noch möglich, überall parken Pressefahrzeuge, Übertragungswagen, Rettungsdienste, Einsatzfahrzeuge der Polizei. Der damalige Innenminister, andere hochrangige Landespolitiker und der Polizeipräsident sind inzwischen auch in der Schule, in den Klassenzimmern. Tatortbegehungen in Begleitung der Polizei. Sie wollen sich ein Bild vor Ort machen, Präsenz zeigen, während die Kollegen der Spurensicherung versuchen, ihre Arbeit zu machen. Zurück in meinem Büro fange ich an, Vernehmungsprotokolle zu schreiben. Eigentlich eine Routinearbeit, doch mich befällt eine tiefe Trauer.
Mit großer Mühe versuche ich zu Papier zu bringen, was mir die Jugendlichen erzählt haben, die nur ganz knapp dem Tod entronnen sind. Doch es gelingt mir nicht, mich zu konzentrieren. Es ist später Nachmittag und in allen Medien weltweit gibt es nur ein Thema: Den Amoklauf von Winnenden. Für mich ist es erstaunlich, wie viele Sachverständige und "Amokspezialisten" plötzlich zu Wort kommen und wie viele Spekulationen über die Tat und den Täter verbreitet werden. Gedanklich stelle ich mich allmählich auf das Ende dieses fürchterlichen Tages ein. Ich bin erleichtert, dass es bald vorbei ist, möchte nur noch nach Hause. Alles ablegen und nichts mehr denken müssen. Einfach nur weg.
Doch gegen 18 Uhr, auf dem Nachhauseweg, klingelt mein Handy. Ein Vorgesetzter erteilt mir den Auftrag, in die Rechtsmedizin des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart zu fahren. Ich soll dort zusammen mit den Rechtsmedizinern die sogenannte Leichensachbearbeitung übernehmen. Ich merke, wie mir das Blut in den Adern gefriert und sage, dass ich mich dazu nicht mehr in der Lage fühle. Ich bin bereits seit über elf Stunden im Dienst und verspüre eine sehr große Leere in mir. Ich bitte, jemand anderen dorthin zu schicken, jemanden, der noch klar im Kopf und belastbar ist. Doch es gibt offenbar niemanden mehr und ich stoße auf wenig Verständnis. Also drehe ich um, gehe zurück zur Dienststelle und fahre von dort aus zusammen mit einem Kollegen nach Stuttgart.
Verzweiflung steigt in mir auf. Ich bin müde und habe Angst vor dem, was mich erwartet. Am Hintereingang des Robert-Bosch-Krankenhauses stehen die Bestattungswagen bereits Schlange als ich dort ankomme. Ein düsterer Anblick, und mich fröstelt. Ich weiß, was in den nächsten Stunden auf mich zukommen wird, mir ist klar, dass es sehr belastend für mich werden wird. Ich stelle den Dienstwagen ab, klemme mir die Tasche mit dem Fotoapparat unter den Arm und gehe schnellen Schrittes hinein.
Im Vorraum der Rechtsmedizin warten bereits die Bestatter, die die toten Kinder und Lehrer vom Tatort hierhergebracht haben. 16 leblose Körper in dunklen Leichensäcken, die meisten davon Schülerinnen. Sie werden nicht obduziert, denn die Todesursache ist klar. Ihre Körper sind von Kugeln durchsiebt. Wir müssen die Leichen entkleiden, ihre Verletzungen genau dokumentieren, die Einschüsse zählen und die Wunden fotografieren. Polizeiroutine, wichtig für die weiteren Ermittlungen und die Rekonstruktion des Tathergangs.
In einem Nebenzimmer der Sektionsräume ziehe ich mich um. Lange Gummischürze, Überschuhe und sterile Handschuhe. Die erste erschossene Schülerin liegt bereits auf dem Seziertisch. Sie hält noch im Tod ihren Stift umklammert und ist nur wenige Jahre älter als meine Tochter. Ich habe in meinem Dienstleben schon viele Tote gesehen, doch der Anblick, der sich mir hier bietet, hat eine andere Dimension. Diese Kinder wurden nicht einfach ermordet, es waren Hinrichtungen. Ein Massaker. So muss sich Krieg anfühlen. Beim Umdrehen einer toten Schülerin fällt mit lautem Klacken ein Projektil aus ihrer Kleidung auf den Metalltisch.
Während der Arbeit verspüre ich immer wieder das starke Bedürfnis, diesen armen Kindern zärtlich über die Wange oder die Haare zu streichen. In unbeobachteten Momenten tue ich das auch und habe Angst, dass mich jemand dabei sehen könnte. Doch ich möchte die Toten trösten. Ich muss an ihre armen Familien denken, an ihre Eltern und Geschwister. Wir arbeiten wie im Akkord. Grelles Licht, kalte Edelstahltische. Es riecht nach Desinfektionsmittel und nach Blut. Jeder Schritt, jeder Satz hallt von den gefliesten Wänden zurück. Es nimmt kein Ende. Irgendwann unterbreche ich die Arbeit für einen Moment. Ich muss raus an die frische Luft, durchatmen und meine Gedanken sortieren.
Am Hintereingang des Krankenhauses sinke ich erschöpft in die Hocke, vergrabe mein Gesicht in den Händen, versuche die Tränen zurückzuhalten. Ich kann nicht mehr. Noch nie in meinem Leben habe ich mich so verzweifelt und hilflos gefühlt. Ich möchte nicht wieder hinein gehen, ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Doch nach wenigen Minuten beende ich meine Pause und mache weiter. Ich fühle mich verpflichtet, diese Arbeit abzuschließen. Denn ich bin es den Opfern und ihren Angehörigen doch schuldig.
Zurück im Sezierraum frage ich, wie weit wir eigentlich sind, wie viel noch vor uns liegt. Die anderen wissen es genauso wenig wie ich. Ich mache dort weiter, wo ich aufgehört habe. Ziehe einer erschossenen jungen Lehrerin den Ehering vom Finger, sie ist die Frau eines Kollegen. Eine Leiche nach der anderen liegt auf dem Tisch. Tote Kinder, tote Erwachsene. Einschusslöcher zählen, fotografieren, dokumentieren. Dazwischen immer wieder Blut, unheimlich viel Blut. So viel, dass es sich nicht mehr wegwischen lässt.
Gegen Mitternacht, nach über vier Stunden, sind wir fertig. Zusammen mit einem Kollegen fahre ich zur Dienstelle nach Waiblingen, um der Polizeiführung das Ende unserer Arbeit mitzuteilen. Danach, gegen zwei Uhr nachts, nach 16 Stunden im Einsatz, kann ich endlich nach Hause. Meine Frau ist noch wach, sie hat den ganzen Tag Radio gehört, Fernsehen geschaut, ein paarmal haben wir telefoniert. Völlig erschöpft sinke ich auf das Sofa und versuche ihr zu erzählen, was ich erlebt habe, wie anstrengend und belastend der Tag war. Doch es gelingt mir nur ansatzweise, ich tue mich sehr schwer damit, die richtigen Worte für das Erlebte zu finden.
Mir fällt nicht mehr ein, über was auf der Dienstversammlung vor dem Einsatz gesprochen wurde oder was ich gegessen oder getrunken habe. Einige Erinnerungen an diesen Tag sind ausgelöscht. Andere haben sich eingebrannt. Fragmente. Einzelne Sinneseindrücke. Gedankenfetzen. Ich fühle mich innerlich leer. Komplett leer, blutleer, gefühlsleer. Ich kann es einfach nicht fassen, was passiert ist. Ich habe den Tod gerochen, ihn gesehen, ihn angefasst. Irgendwann am frühen Morgen gehe ich schließlich ins Bett. Doch obwohl ich mich völlig zerschlagen fühle, finde ich keine Ruhe, keinen Schlaf. Ich liege zwei Stunden wach, die Bilder, Geräusche und Gerüche des vergangenen Tages im Kopf, bis um sechs Uhr morgens der Wecker klingelt.
Am nächsten Morgen ging ich wie immer ins Büro. Zu Fuß gerade mal zehn Minuten. Normalerweise ein Spaziergang, bei dem ich mich in Ruhe auf den Arbeitstag einstimmen konnte. Doch an diesem Morgen war alles anders als sonst. Ich war völlig übermüdet, nahm meine Umgebung kaum wahr. Ich fühlte mich kraftlos und ausgebrannt. Leer, einfach nur leer. Und ich konnte nichts gegen diese starke Angst tun, die immer wieder in mir aufstieg und sich nicht kontrollieren ließ.
Ich konnte den Erinnerungen nicht entkommen, denn am Tag danach drehte sich alles um den Amoklauf. In den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen, im Internet gab es kein anderes Thema. Und polizeiintern liefen die Ermittlungen fieberhaft und unter hohem Zeitdruck. Denn die Öffentlichkeit verlangte nach Erklärungen für diese Tat, bei der 16 Menschen ihr Leben verloren hatten. Ich ging in mein Büro im zweiten Stock, Dachgeschoss, und setzte mich an den Computer. Ich wollte damit beginnen, die ersten Berichte über die Leichensachbearbeitung zu schreiben, die Fotomappen zusammenzustellen. Doch immer, wenn ich die Bilder der toten Kinder anschaute, die Fotos, die ich selbst gemacht hatte, wurde mir schlecht. Ich begann zu schwitzen, spürte Panik im Bauch aufsteigen. Ich musste den Computer ausschalten und das Zimmer verlassen.
Ich war an diesem Tag nicht in der Lage, die Berichte zu schreiben und die Lichtbildmappen zu erstellen, das wurde mir schnell klar. Also beschloss ich, das Ganze um einen Tag zu verschieben, zu warten, bis ich wieder klarer im Kopf war. Letztlich sollte es fast zwei Monate dauern, bis ich diese Arbeit abschließen konnte. Ein Kollege erzählte mir, dass im Mutterhaus, in der Polizeidirektion Waiblingen, eine Polizeipsychologin sei, an die wir uns wenden könnten. Ohne genau zu wissen, was ich eigentlich sagen wollte, bat ich um einen Gesprächstermin, setzte mich in den Dienstwagen und fuhr allein nach Waiblingen. Allein, weil ich mich für meine Probleme schämte. Ich wollte niemanden aus meinem direkten Arbeitsumfeld daran teilhaben lassen, ich wollte es für mich behalten. Denn ich wusste, dass das System Polizei in solchen Fällen sehr hart sein kann. Wie hart, das sollte ich in den nächsten Monaten und Jahren am eigenen Leib zu spüren bekommen. Bei der Psychologin in Waiblingen konnte ich zunächst einen Teil vom all dem abladen, was ich am Tag des Amoklaufes erlebt hatte. Schnell kamen mir dabei die Tränen und ich verspürte ein wenig Erleichterung. Doch die Bilder des Vortages wollten auch danach nicht verblassen. Sie bedrängten mich weiter, die Leichen im Kopf, die ich nicht mehr retten konnte. Ich spürte, wie ich anfing mich zu verändern. Und ich konnte nichts dagegen tun.
Im Büro begann sich meine tägliche Arbeit auf dem Schreibtisch zu türmen. Ich konnte mich beim besten Willen nicht darauf konzentrieren, es fiel mir schwer, Routinearbeiten zu bewältigen. Mein gesamter Alltag fing an, mir zu entgleiten. Ich konnte fast keine Nacht mehr durchschlafen. Und wenn ich mit Herzrasen aus dem Schlaf hochschreckte und nach Luft schnappte, standen die toten Kinder von Winnenden vor meinem Bett. Ich konnte ihre Verletzungen sehen, die Einschusslöcher in ihren Körpern zählen. Sie bedrohten mich nicht, sie standen stumm vor meinem Bett und versperrten mir den Weg aus dem Schlafzimmer. Ihre Gesichter waren deutlich zu erkennen. Manchmal traute ich mich stundenlang nicht, auf die Toilette zu gehen, weil sie dort standen. In anderen Nächten stand mir der Täter gegenüber, schwarz gekleidet, und schoss auf mich. Immer wieder wachte ich laut schreiend und schweißgebadet auf. Das Erlebte war allgegenwärtig. Ich war ständig angespannt, wurde immer gereizter und dünnhäutiger. Wenn meine Frau mich nur darum bat, die Wäsche einzusortieren oder den Müll rauszubringen, flippte ich aus. Ich hatte erst ein halbes Jahr vor dem Amoklauf ein zweites Mal geheiratet und die Beziehung war bis dahin glücklich. Doch immer öfter reagierte ich nun aggressiv und unser Verhältnis verschlechterte sich zusehends.
15.04.2009 Angst, Schlaflosigkeit, Panikattacken. Du kennst dich selbst nicht mehr. Und du weißt nicht, was du machen sollst. Es ist irre. Dazu diese Hilflosigkeit, das Gefühl, gescheitert zu sein, etwas falsch gemacht zu haben. Ich komme mir wie ein Versager vor. Ich ziehe mich immer weiter zurück. Ich merke es, aber ich kann nichts dagegen tun. Auch im Dienst will ich nur meine Ruhe haben. Ich sitze oft allein in meinem Büro und hänge meinen Gedanken nach, nehme nicht mehr an Gemeinschaftsveranstaltungen teil. Ich fühle mich hilflos. Einfach hilflos.
Mir wurde bei der Polizei ein sogenannter Konfliktberater an die Seite gestellt, der mich begleiten sollte. Doch diese Kolleginnen und Kollegen hatten nicht das nötige Fachwissen für den Umgang mit Traumata oder anderen schweren psychischen Erkrankungen. So blieb ich mit meinen Problemen weiter allein. Mit den anderen in meiner Dienststelle konnte ich nicht darüber sprechen. Denn das Thema Tod war und ist bis heute ein großes Tabuthema bei der Polizei. Man spricht untereinander nicht darüber, es wird weggeschoben. Später sagte der Leiter der Polizeidirektion in einem Gespräch einem Gespräch zu mir: Da trinkt man beim Lagerfeuer eine halbe Kiste Bier oder einen Schnaps und dann ist es aber wieder gut.
Ich versuchte, zu funktionieren. Meinen Alltag wiederzufinden, so wie er vor dem Amoklauf gewesen war. Aber die Lebensfreude war verschwunden. Und die Angst weiterhin da. Ein Zustand, der mir bis dahin völlig unbekannt war. Ich, der Kämpfer, der Kampfsportler, den man so gerne als Prellbock bei gefährlichen Festnahmen herangezogen hatte, hatte Angst. Solche Angst, dass ich mich plötzlich nicht mehr in den eigenen Keller traute. Jedes Mal, wenn ich es versuchte, dachte ich, dort liegt ein totes Kind oder es kommt jemand, der mich angreift.
Ich begann, ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten an den Tag zu legen. Alles, wovor ich Angst hatte, vermied ich. Öffentliche Toiletten, Schwimmbäder, weiß gekachelte Räume, Dunkelheit, Friedhöfe. Lange Zeit war es mir nicht mehr möglich, das Grab meines Vaters zu besuchen und zu pflegen. Ich schaffte es nicht mehr, in Metzgereien einzukaufen zu gehen, wegen des Geruchs. Und beim wöchentlichen Karatetraining konnte ich die Toilette nicht mehr benutzen. Jedes Mal sah ich dort die toten Kinder vor mir und Panik kam hoch. Die Fliesen, der Geruch, wie in der Rechtsmedizin. Ich traute mich nicht mehr hinein und musste stattdessen in die Büsche gehen. Mehr und mehr drehte sich mein Tagesrhythmus um dieses Vermeidungsverhalten, um die Angst vor der Angst. Der Alltag wurde zum feindlichen Gebiet, privat und beruflich.
Mein Leben geriet immer weiter aus den Fugen. Ich verlor den Appetit, hatte oft starke Magenschmerzen, entwickelte körperlich eine sehr hohe Sensibilität. Es ging auf und ab, ein permanenter Wellengang, den ich nicht steuern konnte. Es gab Phasen, in denen es mir extrem schlecht ging. Ich war krankgeschrieben, rappelte mich wieder auf, fiel wieder in ein dunkles Loch. Die Löcher wurden tiefer und ich zog mich immer weiter zurück.
Von allem, was mir bisher wichtig gewesen war. Von meiner Familie, von meinen Freunden, von meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Karatetrainer für Kinder und Jugendliche, seit Jahrzehnten Teil meines Lebens. Ich spürte, dass sich etwas Schreckliches in meinem Körper eingenistet hatte und mir war klar, dass es so nicht weitergehen konnte, dass ich Hilfe brauchte. Ich schrieb eine Dienstunfallanzeige und machte einen Termin beim Polizeiarzt aus.
Kurze Zeit später fuhr ich nach Stuttgart. Ich erzählte dem Arzt, welche Probleme mich seit dem Amoklauf plagten. Dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte. Dass ich die Bilder nicht mehr aus meinem Kopf bekam. Dass die toten Kinder immer wieder vor meinem Bett standen. Doch ich stieß auf wenig Verständnis. Er nahm sich nur wenige Minuten Zeit. Er verstehe mein Anliegen nicht, sagte der Polizeiarzt dann zu mir. Das sei nichts. Als Kriminalbeamter sei ich den Anblick von Leichen doch gewohnt. In diesem Fall habe ich es eben in etwas geballter Form erlebt. Ich sei Polizist. Wenn ich keine Leichen sehen könne, dann habe ich meinen Beruf verfehlt."






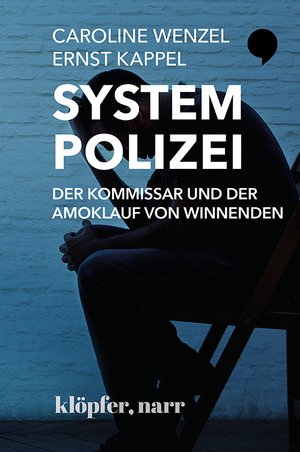









2 Kommentare verfügbar
-
Antworten
Hallo Herr Siller und Kontext Team,
Kommentare anzeigenU.M.
amleider habe ich den Artikel gelesen, da ich vermutete, es gehe um die Strukturen in der Polizei.
Stattdessen gibt es dezidierte Schilderungen der traumatisierenden Vorgänge der über die Maßen belastenden Situation des alleingelassenen Polizeibeamten. Für ihn…