Aber natürlich hat Kretschmann keine Habilitationsschrift verfasst, sondern ein Manifest, wenngleich ein vergleichsweise differenziertes. Und Manifeste sind nun mal grobkörnig. Dass es in der Politik, wo entschieden werden muss, kein Arendt'sches "Denken ohne Geländer" geben kann, ist auch Kretschmann klar. Aber der Weg, der zu diesen Entscheidungen führt, den gilt es aus seiner Sicht möglichst geländerfrei zu gestalten. Eine passende Losung könnte lauten: Ende Geländer!
Wo sich Grüne und FDP treffen
Prägend für Kretschmanns Buch ist der Versuch, eine pluralistische Mitte zu finden und zu formen, die nicht müde und indifferent ist, sondern radikal in ihrer Mäßigung, radikal in ihrem Verantwortungsbewusstsein, radikal in ihrem Realismus. Amüsanterweise forderte letzte Woche der Chef der FDP, Christian Dürr, seine Partei müsse die Partei der "radikalen Mitte" werden. Will er Kretschmann etwa das Wasser abgraben? Die Chancen dafür stehen schlecht. Der Grüne Kretschmann kommt einer solchen Mitte näher als der intellektuell entkernte deutsche Lindneralismus. Es ist einigermaßen bizarr: Da schreibt ausgerechnet ein siebenundsiebzigjähriger Grüner ein Buch, das man von Liberalen erwarten müsste! Natürlich bestehen unterschiedliche Auffassungen zwischen Liberalen und Grünen, was die "Mitte" ausmacht. Aber nicht nur unterschiedliche. Verwehrt sich Kretschmann zwar gegen eine liberale Sicht, "die Freiheit vor allem als Nichtgezwungensein versteht", so verwehrt er sich zugleich wie ein Ordoliberaler gegen den Nanny-Staat und verficht das urliberale Subsidiaritätsprinzip – nicht von oben, sondern von unten soll die Veränderung kommen: "Ich denke da an ein kleines Dorf im Schwarzwald. Dort haben die Bürger sich als Genossenschaft zusammengetan und gemeinsam das ganze Dorf umgebuddelt, um ein Fernwärmenetz mit einer zentralen Hackschnitzelanlage zu errichten."
Sind vielleicht die im Schwarzwald beheimateten Elektrizitätswerke Schönau gemeint? Diese beweisen in der Tat bereits seit den 1990er-Jahren, wie sich Realismus, Pragmatismus, Idealismus unter den Vorzeichen der Energiewende auf lokaler Ebene verbinden und wirtschaftlich scalen lassen.
Ein Lob auf die eigene Politik
Die Elektrizitätswerke Schönau zeigen, wie viel bereits im Kleinen möglich ist, wenn sich Menschen nur zusammenschließen und selber aktiv werden, statt andere durch offene Briefe vor sich her zu treiben, Verantwortung auf "die Strukturen" abzuwälzen und sich in idealistischen Forderungen zu ergehen. Entgegen des im sogenannten Westen weit verbreiteten Zukunftspessimismus ist es aus Kretschmanns Sicht weiterhin möglich, in unseren angeblich gelähmten liberalen Demokratien effektiv zu handeln. Auch hier kommt Arendt ins Spiel. Wenn sie sich nicht in linke, rechte, liberale oder konservative Schubladen packen lassen wollte, so war dies nicht nur Ausdruck ihres Freiheitswillens, der sich am entschiedensten in der Ablehnung totalitärer, gewaltsamer, auf einer alleinseligmachenden Lehre basierenden Staatsformen artikulierte. Es war auch der Versuch, im Politischen überhaupt handlungsfähig zu werden – denn nur dort, wo Menschen nicht bereits durch eine einzige Ideologie der Weg vorgeschrieben ist, können Entscheidungen in Freiheit und Verschiedenheit getroffen werden.
Handeln, so betont Kretschmann in seinem Essay, bedeutete für Arendt die Macht, gemeinsam Veränderungen herbeizuführen. Nur freiheitlich organisierte Gruppen haben Macht. Wenn etwa Armut dazu führt, nicht handeln zu können, so war für Arendt der Skandal nicht nur materieller, sondern auch, ja zuvorderst politischer Art: Arme haben keine Macht und sind deshalb unfrei. Macht war für Arendt damit genuin positiv besetzt und stand in der Tradition eines republikanischen Ethos, eben der "res publica", der "öffentlichen Sache", an der alle aktiv teilhaben können. Dieses Ethos zieht sich als roter Faden durch Kretschmanns Buch. So lobt er sich und seine Regierung für den Ausbau der Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg, unterschlägt aber elegant, dass ausgerechnet das konservative Bayern über mehr direktdemokratische Instrumente verfügt, bei denen es tatsächlich ums Mitentscheiden statt nur Mitreden geht.
Dann doch lieber mehr Staat
Vor dem Hintergrund von Arendts positivem Machtverständnis kritisiert Kretschmann einen "Hyperliberalismus", der die Gesellschaft atomisiere und Menschen dergestalt handlungsunfähig mache. Adepten des Anarchismus könnten hier im Rückgriff auf Peter Kropotkins Buch "Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt" (1902) erwidern, dass nicht nur der Liberalismus, sondern auch ein alle Bereiche des Lebens verwaltender und apparatisierender Sozialstaat atomisierend wirke, da er erlaube, sich aus der Gemeinschaft und der Verantwortung für ebenjene zurückzuziehen: "Die Usurpation aller sozialen Funktionen durch den Staat musste die Entwicklung eines ungezügelten, geistig beschränkten Individualismus begünstigen. Je mehr die Verpflichtungen gegen den Staat sich häuften, umso mehr wurden offenbar die Bürger ihrer Verpflichtungen gegeneinander entledigt." Wer wie Kretschmann den Staat zügeln, Armut verhindern und Bürokratie abbauen will, gerät hier in einen Zielkonflikt, bleibt der Staat doch auch bei Kretschmann der große Ermöglicher. Viele Aufgaben delegiert er letztlich wiederum an Regierungen, Schulen oder an die EU, etwa die Entwicklung alternativer sozialer Medien.
In einem zentralen Punkt aber überzeugt Kretschmann. Was es heute braucht, sind volksfrontartige Konstellationen – kontraintuitive, auch paradoxe, real- und sachpolitische orientierte Bündnisse von Linken, Liberalen, Grünen und Konservativen, deren überlappender Konsens darin besteht, die pluralistische Demokratie erhalten und verbessern zu wollen. Ohne solche Bündnisse haben die autoritären Kräfte leichtes Spiel. Anders als Kretschmann in seinem Buch schreibt, gibt es in einer pluralistischen Demokratie zwar durchaus "Gewinner" und "Verlierer". Doch Gewinn und Verlust sind stets nur vorläufig – erweist sich die eine Form von Politik als nicht praktikabel, kommt bei den nächsten Wahlen eben die andere zum Zuge.
Diskurs statt Gewalt, Realismus statt Frustration
In diesem Zusammenhang ist Kretschmann unbedingt beizupflichten: Bedingung der Möglichkeit pluralistischer Demokratie ist es, Extremisten zu bekämpfen, aber andere politische Gegner nicht zum Feind zu stilisieren, wie es der bis heute einflussreiche NS-Jurist Carl Schmitt forderte. Feinde vernichtet man, mit Gegnern misst man sich in einem fairen Wettbewerb. Zu einem solchen gehört auch eine Diskurskultur, in der es ausgemachte Sache ist, gemäßigte Rechte und Konservative nicht in die Nazi-Ecke oder gemäßigte, pluralistische Linke nicht in die Stalinisten-Ecke zu rücken, wie es die populistischen Kulturkämpfer unserer Tage zu tun belieben – aus diesen ihren "Reductio ad horrendum"-Framings erwachsen die ideologischen Legitimationsdiskurse für Gewalt, bis hin zum Mord, als Mittel politischer Auseinandersetzung.
Auch in einem weiteren Punkt ist Kretschmann überzeugend: Linke Politik, die aus einer Position relativer Machtlosigkeit heraus hehre Ideale entwickelt und Forderungen stellt, diese aber, wenn sie selbst reale Macht erlangt hat, nicht umsetzen kann, ist ein Beschleuniger für Politikverdrossenheit. Besser wäre es, gar nicht erst Verheißungen und Versprechungen zu machen, die man unter kaum je zu kontrollierenden Umständen nicht erfüllen kann – sonst wächst am Ende nur die Frustration ob all des auf dem harten, schmutzigen Boden der Realität zerschellten Paradiesgeschirrs. Diese Frustration schlägt früher oder später in Gewalt um. Aber nicht nur Frustration.
In ihrem von Kretschmann mehrfach zitierten Buch "Über die Revolution" argumentiert Arendt sinngemäß, dass Aufklärung und Revolution dort in Gewaltherrschaft münden, wo Notwendigkeit über Freiheit gestellt wird. Im Namen absoluter Notwendigkeit kann jede noch so brutale Maßnahme gerechtfertigt werden – der Lauf der Geschichte ist ja vorgezeichnet, alle haben ihre Rollen zu spielen. In dem Moment, da die französischen Revolutionäre die Freiheit aus dem Blick verloren, so heißt es bei Arendt, "änderte die Revolution ihre Richtung; von nun an spricht niemand oder doch so gut wie niemand mehr davon, daß das Ziel der Revolution die Freiheit sei; ihr Ziel ist von jetzt an das Wohlbefinden, le bonheur du peuple." Der Jakobiner Robespierre war sich dessen sehr wohl bewusst, wie aus einer von Arendt zitierten Rede hervorgeht: "Wir werden untergehen, weil wir in der Geschichte der Menschheit den Augenblick für die Gründung der Freiheit verpaßten." 1794 starb er selbst durch die Guillotine. Die Revolution frisst ihre Kinder nicht nur, sie köpft sie mitunter auch.
Kluge Theorie mit Mängeln in der Praxis
Dass es zu so etwas nie wieder kommen darf, durchzieht als Primat Kretschmanns Buch. Sein Rezept gegen Autoritarismus und Totalitarismus, gegen jede Form politischer Gewaltherrschaft ist das republikanische Ethos, wie es Arendt vertrat, begleitet von einer Diskursethik, die "ad rem" ("auf die Sache gerichtet") statt "ad hominem" ("auf die Person gerichtet") verficht. Was aber, wenn das Kind des Republikanischen bereits in den Brunnen des Autoritären gefallen ist? Kretschmanns Prinzipien mögen sich durchaus für Prävention und Einhegung eignen. Für Abwehr, Gegenwehr, Notwehr eignen sie sich nur bedingt, zumal unter den Bedingungen einer globalisierten Medienlandschaft und Wirtschaft. Erschwerend kommt hinzu, dass es zumindest Teilen seiner Partei, deren Vorfeld und deren Wählerschaft an Glaubwürdigkeit gebricht.
Als die Grünen 2011 in Baden-Württemberg an die Macht kamen, veröffentlichte Johan Schloemann in der "Süddeutschen Zeitung" einen Artikel mit der Überschrift "Die Stunde der Heuchler". Darin heißt es: "Das ist also das Lebensmodell, wenn die Grünen zur Mehrheitspartei werden: Der Mann arbeitet bei Bosch und macht irgendwelche klimaschädlichen Sachen – Bosch ist zum Beispiel der weltweit größte Hersteller von Verpackungsmaschinen für Konsumgüter –, während die Frau, die gegen Stuttgart 21 ist, im Ökosupermarkt leckeren Biokäse aus der Region und vollmundigen Biowein aus Apulien kauft, möglichst Verpackung vermeidend." Schloeman polemisierte, hatte aber einen Punkt. Wenn man Kretschmanns antitotalitäres Prinzip des "Sowohl-als-auch" trivialisiert, ist genau das die Folge. Kretschmann selbst indes täte man unrecht, wenn man ihn einen "Heuchler" nennte, zumal er immer wider den Stachel seiner eigenen Partei löckt. Sein Buch zeugt davon, dass es ihm ernst ist mit seinem Weg der radikalen Mitte, und dass dieser historisch, philosophisch und ethisch wohlbegründet ist.
Allein, man kann es drehen und wenden wie man will – in der Politik zählen nicht nur gute Programme, Ideen, Prinzipien, Paragrafen, Institutionen, Kompetenzen, sondern auch die Glaubwürdigkeit ihrer jeweiligen Milieus im lebensweltlichen Sinne. Demokratische Politiker und ihre Anhänger müssen auch leben, was sie predigen. Sonst droht ihnen dasselbe Schicksal wie der Kirche im Frankreich des 18. Jahrhunderts, als die Priesterbetrugstheorie aufblühte und sich die Menschen in Massen vom wasserpredigenden, weintrinkenden Klerus abwandten – ironischerweise oft hin zu neuen "politischen Religionen" (Eric Voegelin) von ihrerseits dogmatischem Charakter.




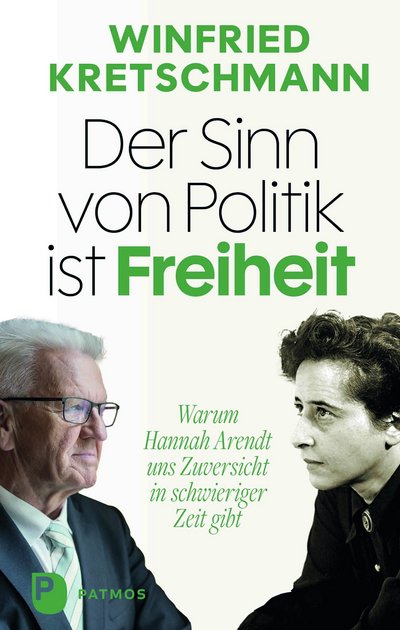







0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!