"Der verlorene Sohn" war das wertvollste Gemälde von Slevogt in seiner Sammlung. Eigentlich hatte Fuchs es bereits in die Schweiz in Sicherheit gebracht, doch 1937 wurde die Reichsfluchtsteuer nach vierjährigem Rechtsstreit endgültig festgesetzt. Der Bescheid lautete auf 29 552 Reichsmark, deutlich weniger als anfänglich. Doch das nützte Fuchs wenig. Im Jahr der Ausstellung "Entartete Kunst" kam viel Kunst auf den Markt. Die Preise fielen. Fuchs musste mehr verkaufen als geplant und ließ zu, dass seine Tochter das Bild in eine Auktion gab. In der Schweiz ursprünglich auf 6000 Mark taxiert, fand es erst im zweiten Anlauf für 1500 Mark einen Käufer: "offensichtlich unter Wert", wie Anja Heuß, bis 2018 Provenienzforscherin der Staatsgalerie, anmerkt.
Heuß hat sich ebenfalls mit der Sammlung Fuchs beschäftigt und einen zwölfseitigen Bericht ins Netz gestellt, in dem es in erster Linie um das Triptychon geht. "Die Frage, ob es sich hierbei um einen verfolgungsbedingten Verkauf gehandelt hat", meint sie zu den Auktionen, "ist in der Provenienzforschung umstritten. Die Tochter war die Auftraggeberin: Sie war nicht jüdischer Herkunft und hatte sich auch in politischer Hinsicht in keiner Weise exponiert." Allerdings handelte sie im Auftrag ihres Vaters. Er war der Besitzer, und er wurde verfolgt, wenn auch nicht als Jude.
Heuß hat auch untersucht, wie das Gemälde schließlich in die Staatsgalerie gelangte. Der Käufer war wahrscheinlich Otto Staebler, Alleininhaber der Chiron-Werke in Tuttlingen, die sich, eigentlich Hersteller chirurgischer Instrumente, ab 1936 zunehmend auf die Rüstungsindustrie verlegten. Als SS-Fördermitglied belastet und zeitweise in Haft, verkaufte Staebler das Unternehmen 1949 an den nicht minder belasteten Fritz Kiehn. Es entspann sich ein Streit um die Sammlung.
Staatsgalerie spricht von "problematischer Provenienz"
In einem komplizierten Hin und Her hatte die Staatsgalerie von Staebler ursprünglich ein Porträt des jüdischen Hirnforschers Ludwig Edinger von Lovis Corinth erhalten. Doch als das Werk erstmals in der Staatsgalerie ausgestellt war, forderten die Erben das Werk zurück. Es war die Zeit von Edingers 100. Geburtstag – und zwei Tage danach starb Staebler. Aus dem Nachlass erhielt das Museum im Tausch den "Verlorenen Sohn". Die Staatsgalerie, schreibt Heuß, "hatte ein geraubtes Kunstwerk restituiert und dafür ein anderes Kunstwerk mit ebenso problematischer Provenienz erhalten."





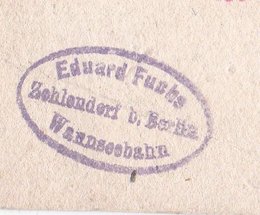










Letzte Kommentare:
Das Land will also eine sozialdemokratische Politik. Nach der neuesten Meinungsumfrage wollen 13 % die SPD wählen. SPD, Grüne und Linke kämen auf 35 %.
"Nach intensiver Debatte beschließen sie einstimmig, ein AfD-Verbot vorzubereiten." Als erstes, der SPD Parteitag kann kein AfD Verbot vorbereiten. Und der SPD Parteitag kann auch kein Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht stellen. Und die...
@Oktarine Ob die vermeintlich diffamierten jemals damit klarkommen, dass Widerspruch und eine abweichende Meinung zur abweichenden Meinung, weder Zensur noch Diffamierung sind. Jeder kennt die AfD, jeder weiß was sie will. Die Zensur von der sie schreiben...
Mit diesem Artikel hat Frau Henkel-Waidhofer danrben gehauen: höchst bedauerlich, finde ich. Die Zwischenüberschrift "Auch Jurist:innen werben für ein Verbotsverfahren" hat zumindest durch die Nennung Frau Barleys nicht das Prädikat...
Das ist nicht die Alternative. Herr Röper hat die diversen Presseförderungsmodelle aus Skandinavien benannt, damit Zweitzeitungen in einer Stadt bestehen konnten und damit Vielfalt. Wo ein Wille ist, gibt es eine funktionierende Presselandschaft. So, wie...