Nur zehn Tage war ich außer Landes. Als ich zurückkam, fühlte ich mich dennoch wie einer, dem man beim Serienschauen den Stecker aus dem Fernseher gezogen hat. In Wahrheit war alles wie immer.
Das Bauernministerium am Kernerplatz stand am Abend im Regen, als wäre es überflüssig. Erich Hausers Stahlplastik ragte in die Wolken, als wollte sie uns warnen, dass uns schon morgen der Himmel auf den Kopf fallen wird. Aus dem chinesischen Restaurant drang noch Licht, was meine Hoffnung schürte, nach einer längeren Eisenbahnreise noch eine gute Suppe einzufahren. Chinesen sind weltweit führend auf dem Gebiet der Wiederbelebungsbrühe. Seit vielen Jahren empfehle ich allen Menschen meiner Umgebung, chinesische Lokale den amerikanischen Burgerbuden vorzuziehen und angesichts unserer geopolitischen Zukunft anständiges Trinkgeld zu hinterlassen. Xi Jinping wird mir als kapitalistischem Arschkriecher mildernde Umstände einräumen.
In der Nacht nach meinem China-Besuch hatte ich einen Traum. Ein Freund erteilte mir den Auftrag, einen Nachruf auf seinen gerade verstorbenen Hund zu verfassen und bei dessen Beerdigung vorzutragen. Der Hund hieß Tricky. Als ich bellend aufwachte, versuchte ich die Sache psychiatrisch einzuordnen. Der Freund im Traum war real, sein Gesicht deutlich zu sehen. Allerdings hat er im wirklichen Leben nie einen Hund besessen. Er hatte sich sogar fast einmal von seiner Frau scheiden lassen, weil sie mit einer Katze nach Hause kam. Die Ehe wurde gerettet, als sich beide auf einen gemeinsamen Karnickelstall im Garten einigten.
Dieser Konflikt erklärt jedoch nicht meinen Traum. Mir fiel ein, dass ich in den Ferien eine Geschichte aus Truman Capotes Buch "Wo die Welt anfängt" gelesen hatte; er brachte sie in einem Alter zu Papier, in dem ich gerade mal meinen Namen schreiben konnte. Seine Story mit dem Titel "Das hier ist von Jamie" erzählt von dem kleinen Jungen Teddy, der im Park einer Frau mit einem kleinen Hund begegnet. Der Drahthaarterrier heißt Frisky und gehört einem Jungen namens Jamie, der so krank ist, dass er das Bett nicht mehr verlassen kann. Am Ende erfahren wir, dass Jamie gestorben ist, vermutlich an Schwindsucht, und ein fremder Mann übergibt Teddy im Park den kleinen Hund. So eine Geschichte kann einen alten Mann auch noch im Schlaf verfolgen. Und aus einem Frisky einen Tricky machen.
Man könnte denken, einiges davon hätte ich erfunden. Leider aber besitze ich nicht Truman Capotes Fantasie, weshalb ich mich als Lohnschreiber auf die bodenständige Tätigkeit des Herumgehens beschränken muss. Womöglich spielt dabei auch mein Blick auf die letzte Strecke eine Rolle. "Das Leben dauert länger, wenn man geht", schreibt der Weltenwanderer Erling Kagge. "Gehen verlängert jeden Augenblick." Dies jedoch heißt auch nicht immer was Gutes. Manchmal geht mir die Geherei auf den Sack. Du kannst einer Sache so lange auf den Grund gehen, bis du daran zugrunde gehst.
Ferienerlebnisse im Bunker
Naturgemäß ging ich auch als Tourist meine Wege, die ich der Einladung zum Wiegenfest eines Freundes zu verdanken hatte (nicht der Mann mit dem Hund aus meinem Traum). Unterwegs war ich im Département Gironde an der Atlantikküste. Zum Meer habe ich mich noch nie hingezogen gefühlt, außer in Filmen mit Seefahrtsverbrechern. Winde, Wellen und Salzwasser sind hundsgemein. Und Sand unter den Füßen sabotiert meinen Vorsatz, als Gewohnheitstier wenigstens halbwegs aufrecht zu gehen.




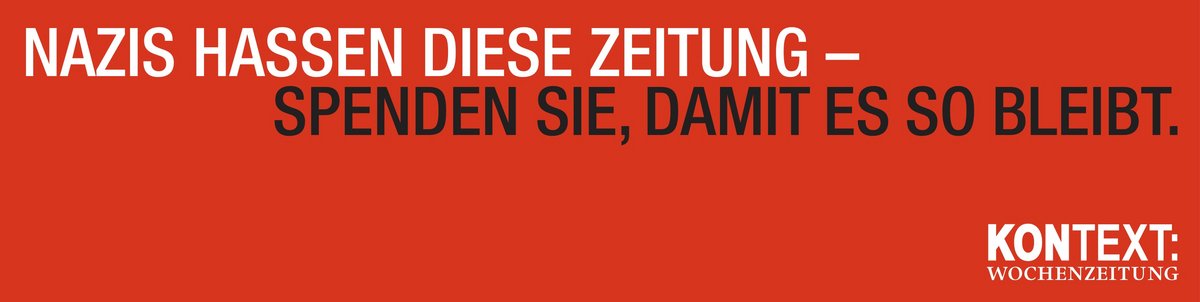







0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!