Es treffen sich zwei Studierende der Journalistik. "Was machst du?" "Ich gehe arbeiten." "Schreiben oder Geld verdienen?" Dieser Dialog ist echt und stammt von der Universität Hohenheim. Viele ZeitungsleserInnen ahnen diese Situation zumindest. "Kann man denn davon leben?" ist eine Frage, die ich in zwei Jahrzehnten Journalismus oft gefragt wurde. Meine Standardantwort kam lange aus der Biologie: "Das ist wie bei der Hummel. Sie kann physikalisch gesehen gar nicht fliegen, aber die Hummel weiß das nicht, also fliegt sie trotzdem." Wenn Leser eine ungeschönte Antwort über Zeilen- und Fotohonorare bekommen, sind sie regelmäßig entsetzt.
Wird das jetzt eine Jammernummer? Nein, ich schreibe gerne und bin damit im Beruf voll im Mainstream: Von den 1055 JournalistInnen, welche die Ludwig-Maximilians-Universität in München für ihre Studie befragt hat, sind rund 70 Prozent mit ihrem Beruf im Allgemeinen zufrieden. Anders sieht es beim Einkommen aus, denn viele können von diesem Beruf nicht leben – auch wenn sie ihn in Vollzeit betreiben. "Selber schuld, hättest du eben etwas Gescheites gelernt?" Haben die meisten: 76 Prozent der Befragten können einen Hochschulabschluss vorweisen.
Ein Minus von über 60 Prozent
An der Befragung, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, nahmen Festangestellte und Freie teil: 39 Prozent der Antworten kamen von Festangestellten, die anderen von Freien. Diese Freien verdienen pro Monat im Schnitt fast 900 Euro netto weniger, jeweils mit Vollzeit berechnet – vor Corona. Eine enorme Einkommenskluft, die sich laut Studie ständig vergrößert.




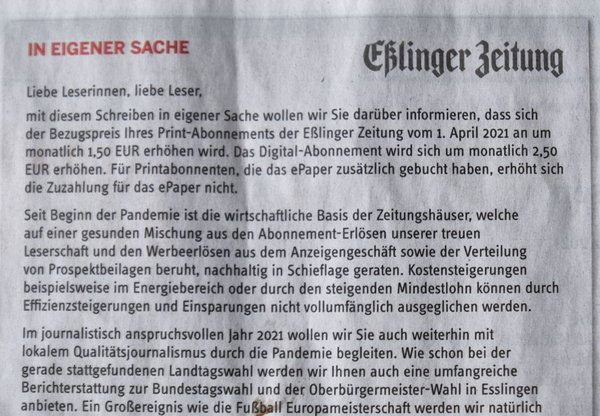









3 Kommentare verfügbar
-
Antworten
Nach fast 20 Jahren als Freie habe ich meinen Idealismus nun endgültig abgelegt und mir einen anderen Job gesucht. Allein durch die wirtschaftliche Sicherheit fühle ich mich erleichtert wie nie. Ich empfehle, die jetzigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen, wo an allen Ecken und Enden Leute…
Kommentare anzeigenCarina
am 30.12.2022